 |
| François Ozon |
Marcus Seibert: Wie machen Sie das, jedes Jahr einen Film zu drehen?
François Ozon: Ich liebe meine Arbeit, folge also vor allem meinem Vergnügen, wenn ich drehe. Es gibt eine Reihe Filmemacher, die leiden beim Drehen. Ich gehöre nicht dazu. Außerdem habe ich zum Glück nie Probleme gehabt, mich von Themen inspirieren zu lassen. Die findet man überall, muss man nur die Augen offen haben und sich umsehen. Das Problem besteht eher darin, einschätzen zu können, was sich umzusetzen lohnt. Aber wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich zwei oder drei Filme im Jahr drehen, wie Fassbinder. Nur leider muss ich ja zwischendurch, wie jetzt für „Dans la maison” („In ihrem Haus”), auch auf Werbetour gehen.
MS: Sie haben Fassbinder erwähnt und beziehen sich oft auf diesen deutschen Filmemacher. Wie kommt dieser Bezug zustande?
FO: Ich konnte mich als Student nie auf eine Art Kino festlegen und fühlte mich von sehr verschiedenen Filmen angezogen. Zwischen all den anderen Studenten, die genau wussten, was sie später machen wollten, habe ich mich mit meinen gegensätzlichen Vorlieben verloren gefühlt. Fassbinders Filme haben mich bestätigt und von dem Druck befreit, mich entscheiden zu müssen. Da war jemand, der völlig frei von Zwängen auftrat, vor nichts Angst hatte und Genres mischte, wie es ihm gefiel. In seinem Werk findet man Sozialdramen, Komödien, Melodramen und immer wieder extrem stilisierte, theatralische Filme. Mich hat diese Vielfalt begeistert, die unerschöpfliche Energie, die Arbeit in einer Art Schauspielerfamilie.
MS: Sie haben eines seiner Theaterstücke adaptiert, „Tropfen auf heiße Steine”.
FO: Ja. Er war siebzehn, als er das geschrieben hat. Mich hat die Reife des Stücks begeistert, diese Hellsichtigkeit, was Paare und Liebesbeziehungen anbelangt. Eigentlich wollte ich das Stück ja gar nicht verfilmen. Ich war gerade selbst dabei, einen Stoff über ein Paar zu schreiben, eine Liebesgeschichte. Aber dann habe ich „Tropfen auf heiße Steine” im Theater gesehen. Das war genau das, was ich schreiben wollte. Da habe ich dann lieber gleich das Stück adaptiert.
MS: Durch die Übersetzung haben Sie dem Fassbinder-Text zu einer Leichtigkeit verholfen, die seine Diktion auf Deutsch nicht hat.
FO: Auf Französisch klingt das immer noch ziemlich künstlich. Aber das war mir egal. Ich mochte dieses Stück. Ich mag es immer noch. Was übrigens diese Künstlichkeit von Übersetzungen anbelangt, so spürt man die auch in Filmen wie „Amour” von Michael Haneke zum Beispiel.
MS: Das Drehbuch wurde von einem französischen Drehbuchautor übersetzt.
FO: Klingt aber eben übersetzt, auch im Stil, wie sich die Figuren äußern.
MS: Sie haben seit dem Fassbinder-Film eine Menge Theaterstücke verfilmt. Theater ist ja für viele eher der Feind des Kinos.
FO: Für mich war das noch nie so. Ich liebe das Theatralische im Film. Viele Regisseure wollen das im Film möglichst zurückdrängen, aufgrund der Kinotradition, die sich vom Theater erst mal absetzen musste. Mir macht das keine Angst. Vielleicht ist das meine Brecht’sche Seite. Ich liebe
Verfremdungseffekte und finde es immer wichtig, dass der Zuschauer nicht vergisst, dass er einen Film sieht. Ich mag diese reflexiven Moment und einen gewissen Abstand in der Erzählweise.
MS: Es ist also für Sie bereits eine Verfremdung, aus einem Theaterstück einen Film zu machen.
FO: Nicht unbedingt. Das hängt von der Adaption ab. Ich habe schon Filme gedreht, wo ich die Theatervorlage eins zu eins umgesetzt habe, zum Beispiel bei „Tropfen auf heiße Steine” oder „Acht Frauen”. Diese Filme spielen mit der Idee des Theatralischen, die immer ein Element des Films gewesen ist. In meinem letzten Film, „In ihrem Haus” habe ich eher versucht, gegen den theatralischen Aspekt des Stückes zu arbeiten und eine filmische Umsetzung zu finden, der man das Theaterstück nicht mehr anmerkt.
MS: Aber am Ende des Films schließt sich wieder ein Vorhang...
FO: ...weil das Leben eine Bühne ist, auf der wir die Darsteller sind, wenn Sie so wollen. Wir alle tragen Masken. Das ist doch die Wirklichkeit.
 |
| Ein Bild aus DANS LA MAISON (F 2012). |
MS: Wie sind sie auf das Stück von Mayorga gekommen. Haben Sie seinerzeit die Inszenierung im Théâtre de la Tempête gesehen?
FO: Ja. Ich werde ziemlich oft von Schauspielern gebeten, mir ihre Stücke im Theater anzusehen. Ich hab im Allgemeinen nicht viel Lust dazu, aber in diesem Fall hat eine Freundin von mir so lange nachgehakt und der Titel des Stücks „Der Junge aus der letzten Reihe” gefiel mir so gut, dass ich schließlich doch hingegangen bin. Und als ich das Stück gesehen habe, war mir sofort klar, das ist was für mich. Es geht um einen frustrierten Literaturlehrer, den ein Schüler dazu bringt, wieder Spaß am Erfinden von Geschichten zu bekommen. Das war noch, bevor ich „Das Schmuckstück” gedreht habe.
MS: Es gibt in ihren Filmen zahlreiche abgeschlossene Räume oder Häuser als Protagonisten, zahlreiche Kammerspiele.
FO: Mein Vater war Wissenschaftler. Er machte immer wieder kleine Experimente mit Mäusen und Fröschen. Ich bevorzuge es, die Figuren zusammen einzuschließen und zu sehen, was passiert.
MS: Im Theaterstück von Mayorga werden die Aufsätze des Schülers vorgelesen. Das haben Sie geändert.
FO: Sie haben das Stück gelesen? Im Original?
MS: In der französischen Fassung. Sie haben die im Stück rezitierten Texte großenteils in Off-Texte zu stummen Szenen verwandelt.
FO: Ja, ich musste das visualisieren, was im Theater über Dialog oder Monolog abgewickelt wird. Im Kino kann eine Seite Dialog durch einen Blick, eine Einstellung, eine Kamerabewegung dargestellt werden. Das ist ein Vorteil. Und es hat mich bei diesem Film besonders gereizt, zu allen Formelementen, die im Theater funktionieren, eine Kinoentsprechung zu finden. Die Amerikaner hätten aus der Vorlage ganz sicher einen Thriller gemacht, der komplett in dem Haus spielt, wo dann auch alle wichtigen Ereignisse stattfinden. Aber mich hat genau das Gegenteil interessiert: Es passiert nur Alltägliches, banale alltägliche Probleme werden gezeigt und das Interesse des Zuschauers gilt weniger dem, was als nächstes geschehen wird, als vielmehr der Frage, wie diese Alltäglichkeiten erzählt werden. Die Erzählweise interessiert mehr als das Erzählte.
MS: Und die ist ironisch...
FO: Im Stück von Mayorga ist dieser ironische Grundton schon angelegt. Ich habe allerdings Wert darauf gelegt, das im Film weiterzuentwickeln. Nach und nach verliert sich der distanzierte, ironische Blick des Schülers und im Laufe des literarischen Unterrichts beginnt er seine Figuren zu lieben, die anfangs als ziemlich klischeehafte Archetypen von ihm dargestellt werden. Von Text zu Text werden das vollständigere Persönlichkeiten, was ja dem Schreibvorgang generell entspricht.
MS: Sie haben vor allem Anfang und Ende des Stückes stark verändert.
FO: Das hängt mit dieser Idee einer eigenständigen filmischen Visualisierung zusammen.
MS: Sie haben dem Film außerdem eine Art Prolog vorangesetzt, in dem es um Schuluniformen geht. Wollten Sie das Stück ursprünglich in England drehen?
FO: Als ich das Stück sah, habe ich gedacht, das würde in England an einer public school besser funktionieren als in Frankreich. Aber die Aussicht, mit englischen Schauspielern zu arbeiten und ein Drehbuch übersetzen und anpassen zu müssen, hat mich davon abgehalten. Aber die Diskussion in Frankreich über die Wiedereinführung von Schuluniformen, über eine Rückkehr zum alten Schulsystem... Gibt es so was eigentlich in Deutschland?
MS: Nicht dass ich wüsste.
FO: Die Diskussion hat mich jedenfalls darauf gebracht, in Frankreich zu drehen, aber den Anfang zu ändern. Ich fand das witzig, zumal in Frankreich vor allem die katholischen Konservativen und Rechten Uniformen fordern, in Großbritannien aber die Labour Party, wegen der Gleichheit der Uniform, die soziale Unterschiede in der Kleidung nivelliert. Germain, die Hauptfigur, ein totaler Individualist, nervt natürlich gewaltig, dass man ausgerechnet „sein“ Vorstadtgymnasium für einen Projektversuch in Uniformität ausgewählt hat. Er schimpft über die „Herde Schafe“, die für ihn alle gleich aussehen, aber zielsicher findet er sofort den einen literarisch begabten Schüler aus dem Haufen heraus.
MS: Sie haben eine Menge Details aus der pädagogischen Debatte beigesteuert. Woher haben Sie diese genaue Kenntnis? Ist das recherchiert?
FO: Meine Eltern waren beide Lehrer. Ich weiß, was es heißt, am Wochenende Klausuren zu korrigieren. Ich kenne diesen undankbaren Aspekt des Lehrerdaseins, dass man eigentlich nie eine direkte Anerkennung der eigenen Arbeit bekommt, sondern erst viel später. Dazu sind Lehrer in Frankreich auch ziemlich schlecht bezahlt. Und die nationale pädagogische Krise scheint ein Dauerzustand zu sein, weshalb dann auch jedes Jahr neue Gesetze und Verordnungen rauskommen, die einem zum Beispiel nicht mehr erlauben, Klausuren mit einem Rotstift zu korrigieren, sondern nur noch in anderen Farben. Das gibt es wirklich!
MS: Im Theaterstück bleiben beide Paare, die Eltern der Familie, in die sich der Schüler einschleicht und der Lehrer und seine Frau zusammen. Der Schüler wird als einziger ausgeschlossen. Bei ihnen trennt sich die Frau des Lehrers von ihrem Mann. Sie haben das Ende des Films auch noch an anderen Stellen erheblich dramatisiert.
FO: Wenn man einen Text adaptiert, dann heißt das manchmal auch, dass man den Text verrät und sich nimmt, was einen wirklich interessiert. Was mir an Mayorgas Text gefiel, war, wie er dem Zuschauer hautnah den Schaffensprozess vorführt. Er zeigt den spielerischen Aspekt, der zum Geschichtenerzählen dazugehört. Er zeigt aber auch die dramatischere Seite, die Manipulation und die mit der Fiktion einhergehende Gefahr, Realität und Fiktion zu verwechseln. Was den Schluss des Theaterstücks anbelangt: Da werden zwar alle möglichen Enden der Geschichte angedeutet, aber der Autor drückt sich um ein echtes Ende, er bleibt lieber theoretisch. Man muss die angesprochenen Entwicklungen ins Spiel übertragen. Deshalb überschreitet die gemeinsame literarische Erfindung von Lehrer und Schüler im Film auch bestimmte Gesetze, die das Stück noch respektiert und wird für beide zur echten Gefahr. Soweit musste das getrieben werden und für mich war außerdem wichtig, dass der Film mit dem Paar Germain und Claude, Lehrer und Schüler endet, die zu einer Einheit geworden sind. Auch wenn das ein eher melancholisches Happy-end ist...
MS: Der Lehrer ist am Schluss in der Psychiatrie...
FO: Nein, im Altersheim, wo ihn sein Schüler besucht. Ich wollte unbedingt auf dem Paar der beiden Koautoren dieser Geschichte enden und den Zuschauer dahin bringen, dass er sich den Film, der dahin geführt hat, selbst erfinden muss.
MS: Germain wird deutlich mehr „bestraft” als im Theaterstück. Es gibt nicht wenige Männerfiguren in ihren Filmen, die für die Unterdrückung ihrer sexuellen Orientierung zum Beispiel bestraft werden.
FO: Wenn Sie darauf hinauswollen: Ich bin kein Sadist.
MS: Es geht da eher um Ihre Vorstellung von „poetischer Gerechtigkeit”.
FO: Poetische Gerechtigkeit? Aha... ein komischer Begriff. Naja, mich interessiert eher, dass sich eine Figur im Laufe des Films entwickelt. Germain ist als Lehrer ein Teil des öffentlichen Lebens mit einer öffentlichen Maske und der ganze Film arbeitet daran, ihm diese Maske vom Gesicht zu reißen und seine wahre Natur dahinter aufzudecken. Germain verliert am Ende seine Frau, seine Arbeit, aber mal nüchtern betrachtet: Die Ehe lief nicht gut, die Arbeit hat ihm keinen Spaß mehr gemacht. Dafür hat er etwas gewonnen. Dieser Schüler hat ihm gezeigt, was am Lehrerdasein toll ist, daran, ein Talent zu entdecken und dessen Vertrauter zu werden. Die beiden haben sich doch gesucht und gefunden. Gut, er hat ein wenig mit dem Feuer gespielt und sich am Spiel mit der Fiktion verbrannt. Er hat die Regeln von Autorität und Erziehung mehrfach überschritten, vermutlich hat ihn die Fiktion dazu verführt zu weit zu gehen. Er benimmt sich wie eine Drogenabhängiger, der für seinen literarischen Stoff alles tun würde. Die Wirklichkeit kommt wie ein Boomerang zu ihm zurück. Das empfinde ich nicht als Bestrafung.
MS: Die Verwechslung von Fiktion und Wirklichkeit spielt in fast allen ihren Filmen eine Rolle.
FO: Buñuel hat mal gesagt, man muss die Träume filmen, als wären sie wirklich, und die Wirklichkeit, als wäre sie ein Traum. Dieser Satz war für mich immer sehr wichtig und es ist kein Zufall, dass in meinen Filmen die Grenze zwischen Wirklichkeit und Phantasie oder Traum immer etwas unscharf sind, weil ich der Überzeugung bin, dass Träume und Phantasien genau so wahr sind, wie das, was wirklich passiert, manchmal sogar mehr.
MS: Sie haben mal gesagt, Sie lieben Monster. Ist der Schüler ein Monster?
FO: Im Gegenteil, für mich ist das ein Engel (lacht). Er ist unschuldig und sehr naiv. Er macht ja nur das, was der Lehrer von ihm fordert. Er erfüllt die Wünsche seines Lehrers so vollständig, dass er dadurch vielleicht stellvertretend zum Monster wird, aber am Anfang ist er ganz unschuldig.
MS: Sind verborgene Wünsche das eigentlich Monströse?
FO: Nein. Jeder hat eine monströse Seite, die muss man akzeptieren. Und Claude ist Voyeur und Manipulator. Das bin ich auch, alle Regisseure sind das. Hitchcock hat das als erster zugegeben. Wenn man Regisseur ist, muss man damit leben.
MS: In Ihren Filmen gibt es selten männliche Hauptfiguren...
FO: ...Das ist reiner Zufall.
MS: ...dafür immer starke Frauen.
FO: Na und? Es wird nie jemand gefragt, warum er starke Männerfiguren in seinen Filmen bevorzugt. Ich finde es völlig normal, weibliche Figuren zu zeigen, die wirkliche Charaktere sind. Man ist so daran gewöhnt, Frauen in amerikanischen Filmen zum Beispiel zum dekorativen Schmuckstück degradiert zu sehen, dass es jedes Mal zu Freudenausbrüchen kommt, wenn ein Regisseur einer Frau die Hauptrolle in einem Film gibt. Das ist wirklich unglaublich, aber leider ist das so. Mich interessiert an weiblichen Figuren oft, was Fassbinder über die Filme von Sirk gesagt hat: „Bei Douglas Sirk, da denken die Frauen.“ Im Film assoziiert man Frauen eher mit Innerlichkeit, Männer mit Handlung, mit Krimi und Thriller. Weil ich Filme mag, in denen es um Wahrnehmung und Gefühle geht, scheint das mehr dafür zu sprechen, weibliche Hauptrollen zu wählen. Aber in meinen letzten beiden Filmen sind die Hauptfiguren Männer. Allerdings sind in beiden Fällen die Frauen die eigentlich aktiven Figuren.
MS: Michael Haneke, weil Sie den vorhin erwähnten, hat erklärt, er zieht es vor, Frauen in Hauptrollen oder Geschichten aus der Sicht von Frauen zu zeigen, weil sie gesellschaftlich leichter zu Opfern werden und seine Sympathie auf der Seite der Opfer liegt.
FO: Das ist bei mir nicht so. Ich verstehe das Argument, aber wenn ich oft Frauen in Hauptrollen besetze, dann weniger aus politischer Überzeugung als aus Neigung. Ich liebe Schauspielerinnen und finde, dass die meisten intelligenter sind als ihre männlichen Kollegen. Sie riskieren mehr in einem Film, stellen sich und das Bild, das sie von sich haben, grundsätzlicher in Frage. Männliche Schauspieler sind oft Gefangene eines Bildes von sich selbst oder eines Status, den sie nicht verlieren wollen. Die Schauspieler, die ich am liebsten besetze, sind „feminine“ Typen wie Depardieu, der vielleicht nicht so wirkt, aber eine echte Schauspielerin ist, wie Catherine Deneuve festgestellt hat.
MS: Wenn man mit Ihnen zusammenarbeitet, soll man sich einfach von Ihnen führen lassen – sagen einige Schauspielerinnen. Ein ziemlicher Vertrauensbeweis...
FO: Das ist ein Vertrauensbeweis. Aber Vertrauen ist für mich auch das Wichtigste beim Drehen. Sobald es eine Vertrauensbasis gibt, findet ein echter Austausch statt und man kann sehr weit zusammen gehen. Aber eine einheitliche Vorgehensweise, wie man mit Schauspielern umgehen soll, gibt es nicht. Jeder ist da anders und jeder hat andere Bedürfnisse. Auf die muss man sich jedes Mal neu einstellen. Wenn ich mit jungen Schauspielern wie Ernst Umheuer zusammenarbeite, dann gehe ich mit ihnen anders um als mit Fabrice Luchini. Ich bin da sehr offen und auch kein Diktator am Set. Im Gegenteil, ich versuche, die Schauspieler an der Entstehung des Films teilhaben zu lassen und oft kann man sich auf ihre Intuitionen verlassen. Ich nutze das jedenfalls, was sie mir anbieten.
MS: Was ist dann ihre Vorstellung von Schauspielregie?
FO: Ich versuche, mich anzupassen. Darin besteht meiner Ansicht nach Schauspielführung. Ich kann mit einer erfahrenen Schauspielerin wie Catherine Deneuve nicht genau so arbeiten wie mit einem jungen Schauspieler. Die eigentliche Arbeit mit Schauspielern besteht in der Anpassung an sie, die dazu führt, dass sie Vertrauen fassen, sich geliebt fühlen. Dann geben sie alles für ihre Rolle. Ich bin kein Manipulator und mag es nicht, mit Druck zu arbeiten oder am Set als Diktator aufzutreten. Das gehört auch zu dem, was Schauspieler normalerweise nicht mögen. Gut, wenn einer möchte, dass ich ihm gegenüber sadistisch werde, bitte, das kann ich auch. Aber normalerweise ziehen sie es vor, in Harmonie zu arbeiten, was auch meinen Vorstellungen entspricht.
MS: Was haben Sie gemacht um die Darsteller von Claude und Germain aufeinander einzustimmen?
FO: Das war denkbar einfach, weil es im Film um die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler geht und hier ein erfahrener Schauspieler mit einem Lehrling zusammenarbeiten sollte. Das war eine quasi-dokumentarische Situation. Ich musste nur die Kamera hinstellen und zusehen. Wir haben besonders darauf geachtet, in der Chronologie zu drehen, damit das erste Zusammentreffen der beiden auch die Szene ist, in der sich Lehrer und Schüler kennenlernen. Es gab da eine sehr genaue Entsprechung zwischen Filmsituation und der persönlichen Erfahrung miteinander. Ich habe Fabrice Luchini nur gebeten, er soll mit Ernst sprechen wie mit einem jungen Kollegen, der noch völlig unbeleckt ist, und dem er bei der Ausübung seiner Kunst helfen will.
MS: Das ist der dritte Film über Schriftsteller nach „Swimming Pool” und „Angel”...
FO: Tja, das ist vielleicht meine Art, über meine Arbeit zu reden, auch wenn das keine Filme über Filmemacher sind. Es fällt mir durch die Distanzierung der Literatur leichter, über meine Arbeit zu reden. „Swimming Pool” war ein Film über die Inspiration, woher kommt sie und wie nährt man sich dabei von Phantasien und wirklichen Ereignissen. „Angel” war ein Film über die Lügen der Fiktion, und wie man sich darin bis zum Verlust der intellektuellen Bodenhaftung verlieren und daran sogar sterben kann. In ihrem Haus behandelt die Inszenierung, die das Erfinden einer Geschichte darstellt, aber auch, wie eine Geschichte entsteht und wie Figuren entstehen.
MS: Zwei davon nach literarischen Vorlagen. Ihre Filme nach eigenen Drehbüchern sind nur selten Komödien. Warum?
FO: Ich schreibe lieber dramatische Sachen, was mich aber nicht davon abhält, Komödien im Theater zu mögen. Es gibt aber eine Ausnahme: Sitcom habe ich selbst geschrieben.
MS: In einem Interview haben Sie gesagt, man kann keine Melodramen mehr drehen wie Sirk.
FO: Das sieht man an Filmen wie Todd Haynes „Far From Heaven”, dem Remake von „All That Heaven Allows”, der sehr an der Oberfläche bleibt. Man muss heute indirekter vorgehen, wenn man mit ein Melodram drehen will. Sirk war da in seiner Zeit überzeugend, aber es haben sich auch die Verhältnisse erheblich geändert.
MS: Sie nennen als Lehrer während Ihres Studiums an der FEMIS so unterschiedliche Filmemacher wie Eric Rohmer, Jean Douchet und Joseph Morder.
FO: Das waren bis auf Jean Douchet, den ich in der FEMIS kennengelernt habe, Lehrer, die ich schon an der Sorbonne hatte. Eric Rohmer war für mich besonders wichtig, weil ich ihn als Filmemacher bewundert habe, seine Filme sehr mochte und auch seine Arbeitsweise, die immer sehr produktionsfreundlich ausgerichtet war, auch darin, dass er auf Filme mit großem Budget immer kleine hat folgen lassen und umgekehrt. Er wusste unglaublich viel und hat das auch in seinen Kursen an der Sorbonne weitergegeben. Obwohl Rohmer immer ganz als Intellektueller auftrat, waren seine Kurse unglaublich pragmatisch und praktisch ausgerichtet. Er war ziemlich knauserig und hatte deshalb als wichtige Empfehlung so Tipps, wo man einen Teppich, wenn man den für einen Film braucht, besonders billig bekommen kann, da und da bei Saint-Maclou (eine Billigkaufhauskette, Anm.). Wir hatten theoretische Vorträge im Stile Rohmers erwartet, stattdessen gab er uns Tipps, wo man günstig Tapeten für die Filmdekoration bekommen kann. Diese prosaische Seite ließ Filmemachen auf einmal sehr konkret erscheinen. Und um uns zu erklären, wie man schneidet, führte er uns ein Tennismatch zwischen Borg und Connors vor. Am Anfang erklärte er noch bei jedem Schnitt, was Nahaufnahmen, amerikanische Einstellungen und Totalen sind, aber schließlich sagte keiner mehr was und es lief dann nur noch das Match. Wir haben uns das komplett angesehen, eine ganze Unterrichtseinheit lang. Das war sehr lustig. Er hat erst sehr viel später, als ich ihn extra mal deshalb aufgesucht habe, erfahren, dass ich einer seiner Schüler in diesen Kursen war und war dann auch sehr stolz darauf. Das war einer der Momente, wo mir klargeworden ist, wie undankbar das Lehrerdasein ist, weil man im Moment nie weiß, wie wichtig man vielleicht für einen Schüler ist oder werden kann. Das erfährt man immer erst lange Zeit danach, wenn überhaupt. Er war sehr zufrieden, dass ich in ihm meinen Lehrer gesehen habe und dass ich viele seiner Schauspieler in meinen Filmen eingesetzt habe. Ich habe schon mit Melvil Poupaud, Fabrice Luchini und Marie Rivière gearbeitet, die alle seinem filmischen Universum entstammen.
MS: Sie haben mit Super8-Filmen angefangen.
FO: Ja. Mein Vater hat immer Super8-Filme gedreht, von seinen Reisen nach Mexiko zum Beispiel. Aber auch Familienfilme. Irgendwann habe ich gemerkt, er macht das ziemlich schlecht und ich habe das übernommen. Und dann habe ich die Kamera auch für andere Sachen verwendet. Die Videotechnik war damals noch nicht so weit. Das Filmen in Super8 war jedenfalls für mich eine sehr gute Schule. Joseph Morder ist ein Spezialist für Super8. Wir bekamen da eine Filmrolle von drei Minuten, und waren gezwungen, damit einen ganzen Film zu bestreiten. Heute kostet das Videomaterial nichts mehr. Deshalb wird auch anders gearbeitet. Mit Super8 musste man immer gut im Voraus planen und sich genau überlegen, was man drehen wollte.
MS: Wie arbeiten Sie heute am Set?
FO: Ich sitze hinter der Kamera.
MS: Ach so...
FO: Ja. Das hat sich mit der Erfahrung von Super8-Filmen zu tun. Damals habe ich meist Filme ohne Ton gedreht, meine Familienmitglieder waren meine ersten Darsteller. Daher stammt aber wohl mein Bedürfnis, den Schauspielern auf diese Weise nahe zu sein. Ich muss den Bildausschnitt selbst bestimmen können, weil das meine Sicht der Schauspieler bestimmt. Viele Regisseure sitzen lieber vor einem Ausspielmonitor, wollen nicht so nahe an der Drehsituation dran sein, aber für mich ist der Platz direkt hinter der Kamera der beste, um in Kontakt mit meinen Darstellern zu sein und mich ganz auf das zu konzentrieren, was vor der Kamera passiert. Wenn man nur daneben steht, sieht man den Tonangler, die falschen Dekos und da wird es für mich schwierig, mich zu konzentrieren.
MS: Was macht dann der Kameramann, den es ja laut Abspann in allen ihren Filmen gibt?
FO: Lichtsetzen und das Bild kontrollieren. Es gibt Kameraleute, die sind sehr froh, wenn sie sich ganz um das Licht kümmern können. Andere sind natürlich frustriert. Wenn man hinter der Kamera sitzt, tritt man in die wichtigste Beziehung mit den Schauspielern. Man ist sehr nahe an ihnen dran und manchmal vermissen die Chefkameraleute diesen besonderen Draht, der sich da ergibt.
MS: Die Schauspieler spielen also, so sagen das zumindest einige über die Arbeit mit François Ozon, via Kamera direkt mit Ihnen und für Sie?
FO: Die mögen das sehr. Die Arbeit wird dadurch auch schneller, alles ist viel einfacher. Die Schauspieler lieben es, so direkt betrachtet zu werden. Ich weiß, dass viele Schauspieler es hassen, wenn der Regisseur sich in einem Nebenraum verbarrikadiert, der wie ein Kino aussieht und seine Anweisungen nur über den Assistenten ans Set tragen lässt. Bei mir ist die Rückkoppelung sehr viel direkter.
MS: Ist das eine Empfehlung an junge Filmemacher?
FO: Ich bin kein Lehrer. Ich fühle mich eher noch selbst wie ein Student.
MS: Dann tun sie doch mal so, als wären Sie Lehrer. Was würden Sie Filmstudenten heute empfehlen?
FO: Na gut. Ich glaube jedenfalls, man muss viel drehen und viele Filme sehen. Zumindest bei mir hat das erheblich zu meiner Ausbildung beigetragen, die Filme anderer Regisseure zu sehen. Beim Entdecken dieser Filme bildet man allmählich seinen eigenen Geschmack heraus und seinen Stil. Man sollte versuchen, so viel zu üben, wie möglich. Und man sollte das drehen, was man wirklich will. Es ist heutzutage so einfach, an eine Kamera zu kommen und Schauspieler zu finden – und nicht bloß die eigene Familie. Man muss sich dazu zwingen, eine Geschichte auch in zehn Minuten zu erzählen.
MS: War das Milieu der FEMIS wichtig für Sie? Immerhin haben Sie bei einer Menge Filme am Anfang mit anderen Studenten zusammengearbeitet.
FO: Ich habe die FEMIS vor allem als eine große Produktionsgesellschaft angesehen und auch so genutzt. Die Schule ist reich. Wir hatten angesehene Lehrer wie Polanski oder Jean Douchet. Aber wir hatten auch alle Mittel zur Verfügung, um Filme zu drehen, Geld, Equipment, Filmteams. Das war toll.
MS: Gibt es eigentlich auch manchmal Schwierigkeiten, Projekte zu finanzieren?
FO: Oh ja. Das ist nicht immer einfach. Für „In ihrem Haus“ war es einfach, weil Fabrice Luchini in Frankreich sehr populär ist. Ich konnte den Film ein wenig auf seinem Namen aufbauen und auf dem Erfolg von „Das Schmuckstück”. Aber ich mache ja auch keine wirklich teuren Filme, keine aufwendigen Blockbuster. Meine Filme kosten nicht viel und sind auch deshalb in der Regel gut zu finanzieren. Aber ich hatte schon enorme Schwierigkeiten mit der Finanzierung, zum Beispiel bei "Unter dem Sand". Alle fanden die Idee, einen Film mit Charlotte Rampling zu machen, unverständlich. Sie war über den Punkt ihrer größten Popularität hinaus und dann noch eine morbide Geschichte über das Trauern mit ihr zu erzählen, hat niemanden interessiert. Wir haben dann trotzdem angefangen, auf 35mm zu drehen. Aber als uns das Geld ausging, mussten wir den Dreh unterbrechen. Eine Produktionsfirma aus Italien hat uns aus der Not geholfen und wir konnten den Film schließlich auf 16mm fertig drehen. Aber Charlotte und ich, wir waren einfach völlig von dem Stoff überzeugt und wollten den drehen. Wir haben uns dafür wirklich ins Zeug gelegt.
MS: Warum haben Sie eigentlich nie in Amerika gedreht?
FO: Regisseur in Amerika ist etwas ganz anderes als in Frankreich. Bei uns ist der final cut selbstverständlich Sache des Regisseurs, der Regisseur steht im Zentrum des Films. In Amerika steht der Produzent im Zentrum des Films, der Regisseur ist nur ein Techniker unter anderen im Dienste des Produzenten. Deshalb ist mein Interesse dort zu arbeiten, nicht gerade ausgeprägt. Warum soll ich meine Freiheit aufgeben und mich den Kriterien der Hollywood-Produktion unterwerfen, die nicht mal dem entsprechen, was ich gerne machen möchte? Ich fühle mich in Frankreich sehr wohl und denke, dass man auch dort das Geld zusammen bekommt. Sollte ich mal einen Blockbuster drehen wollen, was eher nicht der Fall sein wird, kann ich mir das ja noch mal überlegen.
In Frankreich haben wir außerdem das Glück, eine finanziell stark subventionierte Kinolandschaft zu haben. Die Regierung sieht Film als eine Kunst und einen wichtigen Industriezweig an und das führt dazu, dass Frankreich das einzige europäische Land ist, in dem die Filmlandschaft dem amerikanischen Einfluss nennenswert Widerstand leistet. Die inländischen Erzeugnisse machen immerhin 40% des Kinomarktes aus. Das französische Kino ist vielfältig und reichhaltig, es gibt populäre Komödien, Blockbuster und Autorenfilme. Deutsche Filme, die in Frankreich herauskommen, sind eigentlich ausschließlich Autorenfilme, zugespitzte Dramen. Deutsche Komödien gibt es in Frankreich nicht. Dagegen lief ja "Ziemlich beste Freunde" wunderbar in Deutschland, aber das ist für mich ein durch und durch amerikanisch gemachter Film, der nichts mit dem Film zu tun hat, den ich drehen will.
MS: „Angel” ist der einzige Film, den sie außerhalb Frankreichs, nämlich in Großbritannien gedreht haben.
FO: Ich habe ihn in England gedreht, aber mit einem üppigen europäischen Budget. Ein durch und durch europäischer Film! Und übrigens der einzige, der nie in den Vereinigten Staaten gezeigt worden ist. Das zeigt, wie wenig die amerikanischen Vorstellungen mit den europäischen übereinstimmen.
MS: Die europäischen sind auch sehr verschieden. Könnten Sie sich etwa vorstellen, einen Film in Deutschland zu drehen?
FO: Ich habe einen Stoff, der in Deutschland spielt. Ich glaube auch, dass ich in der Lage wäre, hier Regie zu führen. Als ich das einzige Mal mit deutschen Schauspielern gearbeitet habe, ist mir vor allem aufgefallen, es gibt in Deutschland nicht dieses Starsystem wie in Frankreich. Hier gibt es weniger diese obsessive Vorliebe für Berühmtheiten, die Schauspieler sind untereinander gleichgestellt. Das verändert auch die Beziehungen zur Regie. Was man über die französischen Stars sagt, dass sie alle ihre Texte nicht können, stimmt übrigens leider. Das hindert sie nicht daran, gut zu sein. Ein Schauspieler wie Gérard Depardieu, mal abgesehen von seinen öffentlichen Äußerungen, hat kein Gedächtnis mehr. Überall um ihn herum muss man Zettel aufhängen. Aber das sieht am Ende kein Zuschauer, weil er einfach gut ist.
Was mich im Augenblick aber mehr reizen würde, wäre, mit einer der etwas älteren amerikanischen weiblichen Stars zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, mit älteren Darstellerinnen zu arbeiten, und in den USA gibt es eine Menge hervorragender Schauspielerinnen zwischen 40 und 50, die gerne mal in Frankreich drehen würden.
---
Da
das Gespräch nun doch nicht im Revolver-Heft erscheint, hier auf dem
Blog. Abdruck, auch in Auszügen, nur mit meiner ausdrücklichen
Genehmigung. Lesen darf natürlich jeder! Geführt wurde das Gespräch im
Rahmen der Cologne Conference am 5.10. 2012 im Museum für Angewandte
Kunst in Köln. Vielen Dank an François Ozon.
Marcus Seibert
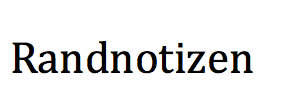
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen